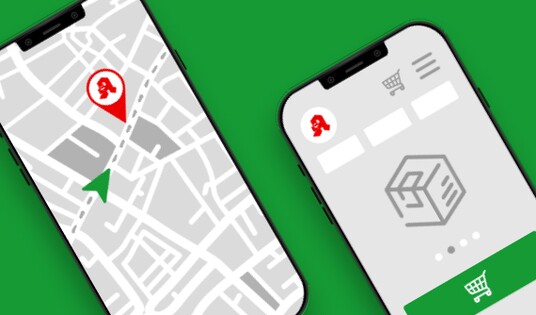Chronisch-obstruktive Bronchitis besser verstehen

Der Alltag mit einer chronisch-obstruktiven Bronchitis kann herausfordernd und sehr belastend sein – nicht nur körperlich, sondern auch für die eigene Psyche: Dauerhaft entzündete sowie verengte Atemwege führen zu Atembeschwerden und schränken Betroffene in vielen Situationen erheblich ein. Verschiedene Maßnahmen können die Krankheit zwar nicht heilen, dafür Ihre Beschwerden lindern und die Lebensqualität erhöhen. In diesem Beitrag erfahren Sie, um welche es sich dabei handelt und wie Sie Ihren Alltag mit der chronisch-obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) gestalten können.
Was ist eine COPD?
COPD steht für chronic obstructive pulmonary disease, zu Deutsch: chronisch-obstruktive Lungenkrankheit. Bei der Lungenerkrankung sind die Atemwege lebenslang entzündet (chronische Bronchitis) und gleichzeitig verengt (obstruktiv)1.
Unter COPD fallen mehrere Krankheitsbilder, bei denen die Anzeichen aber alle ähnlich sind. Grundsätzlich unterscheiden Fachleute zwischen zwei Hauptformen2:
- COPD mit chronischer Bronchitis (Entzündung der Schleimhaut in den unteren Atemwegen)
- COPD mit Lungenemphysem (Zerstörung von Lungengewebe)
Ausgangspunkt für die entzündeten und verengten Atemwege ist eine Störung des Selbstreinigungsmechanismus der Atemwege, genauer gesagt der feinen Luftröhrchen in den Bronchien3.
Im gesunden Atmungssystem sorgt die sogenannte mukoziliäre Clearance dafür, dass Schadstoffe und Krankheitserreger aus der Lunge abtransportiert werden3.
Die Schleimhaut der Atemwege ist mit unzähligen kleinen, beweglichen Flimmerhärchen (Zilien) besetzt, die unter anderem Staub und Keime aus der Lunge abtransportieren3. Vergleichen lässt sich das mit einem Getreidefeld im Wind. Lässt der Wind nach, bewegen sich die einzelnen Halme nicht mehr. Zerstörte Flimmerhärchen können sich ebenso nur noch wenig bis gar nicht bewegen und keinen Schleim aus den Bronchien befördern, wodurch sie verstopfen3.
Wenn sich die Krankheit schubweise verschlimmert, sprechen Mediziner von Exazerbationen3. Insbesondere dann sollte eine schnelle Behandlung erfolgen.
Erst, wenn zu einer chronischen Bronchitis eine obstruktive Komponente, also die Verengung der Atemwege hinzukommt, sprechen Mediziner von einer COPD2.
COPD-Symptome zusammengefasst
Wie erkennt man COPD? Oft bemerken Betroffene Beschwerden erst im fortgeschrittenen Verlauf, weil die Lunge im Alltag selten auf Hochtouren läuft und so immer noch Luftreserven zur Verfügung hat3. Deshalb kann ihre Leistung schleichend abnehmen, ohne dass es auffällt. Die ersten Anzeichen zeigen sich meist bei körperlicher Anstrengung. Aber erst, wenn die Lungenschäden zunehmen, erkennt man eine COPD an den sogenannten AHA-Symptomen:
- Atemnot,
- Husten und
- Auswurf.
Am Anfang verwechseln Betroffene die COPD-Symptome häufig mit einem „einfachen Raucherhusten“3. Kommen immer stärkerer Husten und größere Mengen Auswurf hinzu, deutet dies auf eine beginnende COPD hin. Außerdem typisch: ein Atemgeräusch (Pfeifen oder Brummen) beim Ausatmen. Im weiteren Verlauf verstärken sich die Beschwerden und es tritt Atemnot auf. Im fortgeschrittenen Stadium sind die Atemwege so stark verengt, dass schon in Alltagssituationen wie beim Waschen oder Anziehen das Atmen schwerfällt3. Sogar wenn Betroffene sich ruhig verhalten, kann Luftnot auftreten3.
Besonders bei häufigem und lang anhaltendem (länger als vier Wochen) Husten sollten Sie einen Arzt aufsuchen4. Weil sich Betroffene oftmals stark in ihrem Leben eingeschränkt fühlen, kennen viele COPD-Patienten zudem das Gefühl von Depression oder Fatigue, also körperlicher sowie seelischer Erschöpfung6. Auch damit müssen Sie nicht alleine fertig werden: Lassen Sie sich frühzeitig von Ihrem Arzt beraten oder von Angehörigen unterstützen – zum Beispiel bei der Bewältigung alltäglicher Aufgaben, die Sie aufgrund der Erkrankung nicht mehr nach Ihren Wünschen bewerkstelligen können oder möchten.
Chronischer Husten ist in der Regel das erste Symptom einer COPD2. Allerdings neigen viele Patienten – insbesondere Raucher – dazu, das Anzeichen zu verharmlosen. Kontaktieren Sie lieber frühzeitig einen Arzt, da eine zeitige COPD-Behandlung den Verlauf deutlich mildern und verlangsamen kann2,7.
Übrigens: Neben Erwachsenen können auch Kinder die Lungenerkrankung entwickeln. Wichtig zu wissen ist, dass bei ihnen eine obstruktive Bronchitis auch ohne chronischen Verlauf möglich ist. Auslöser sind häufig Viren8.
Welche Ursachen und Risikofaktoren gibt es für COPD?
Hinter einer COPD können viele Ursachen stecken. Haupt-Risikofaktor für die Krankheit bildet das Rauchen: In ungefähr 80 bis 90 Prozent der Fälle9. Rund 40 bis 50 Prozent aller lebenslangen Raucher erkranken an chronisch-obstruktiver Bronchitis10.
Grundsätzlich erhöht alles, was mit Entzündungen in der Lunge verbunden ist, das Risiko für eine COPD. Dazu zählt neben Tabakrauch – ob aktiv oder passiv – auch:
- genetisch bedingter Enzym-Mangel: Selten haben Menschen von Geburt an einen Alpha-1-Antitrypsin (AAT)-Mangel9. Etwa ein bis zwei von 100 COPD-Erkrankten sind betroffen3. Fehlt das Enzym, können Schädigungen des Lungengerüsts eintreten10. Die Folge: Das Risiko für ein Lungenemphysem (Überblähung der Lunge, zerstörte Lungenbläschen) erhöht sich3.
- Umwelteinflüsse/Schadstoffe: Hohe Luftverschmutzung mit Ozon, Schadstoffen und Feinstaub können eine COPD begünstigen10. Fachleute vermuten zudem Rauch aus der Verbrennung von Holz, Kohle, Pflanzenteilen oder Dung als wichtigen Risikofaktor für COPD10.
-
Faktoren im Berufsleben: Menschen, die an ihrem Arbeitsplatz bestimmten Gasen, Dämpfen oder Staubarten ausgesetzt sind, entwickeln überproportional häufig eine COPD10.
-
Infektionen der Atemwege: Lungenforscher vermuten einen Zusammenhang zwischen wiederkehrenden, schweren Atemwegsinfektionen in der Kindheit und einer eingeschränkten Lungenfunktion10. Deshalb zählen frühere wiederholte Atemwegserkrankungen zu den COPD-Risikofaktoren10.
COPD-Stadien und Verlauf
Die passende Therapie von COPD-Patienten richtet sich danach, in welchem Stadium der Krankheit sie sich befinden. Das Stadium bestimmt der Mediziner, indem er zum einen die Lungenfunktion testet und zum anderen das Ausmaß der Beschwerden bestimmt.
Einteilung der Stadien nach GOLD
Wie stark die Lunge bei einer COPD beeinträchtigt ist, stellt der Arzt mithilfe der sogenannten GOLD-Stadien fest. Die Abkürzung steht für Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Dahinter steckt eine Kommission, die weltweit einheitliche Behandlungen einer chronisch-obstruktiven Bronchitis vorsieht.
Grundlage ist ein Lungenfunktionstest, in dem ein Mediziner unter anderem die sogenannte Einsekundenkapazität (FEV1) bestimmt. Der Wert gibt das Luftvolumen an, das der Patient innerhalb einer Sekunde mit höchster Kraft ausatmen kann11. Es gibt vier verschiedene COPD-Stadien nach GOLD12:
-
GOLD 1: Das erste GOLD-Stadium bildet das Anfangsstadium der COPD. Hier erreicht die ausgeatmete Luftmenge mindestens 80 Prozent des Sollwertes eines gesunden Menschen (FEV1 ≥ 80 %).
-
GOLD 2: Im weiteren Verlauf sinkt das Luftvolumen auf 50 bis 80 Prozent des Sollwertes eines gesunden Menschen (50 % ≤ FEV1 < 80 %).
-
GOLD 3: Stadium 3 bezeichnet den Zustand, in dem Patienten in einer Sekunde etwa 30 bis 50 Prozent des Sollwertes gesunder Menschen an Luft ausatmen können (30 % ≤ FEV1 < 50 %).
-
GOLD 4: Im vierten und schwersten Zustand beträgt die ausgeatmete Luftmenge weniger als 30 Prozent des Sollwertes (FEV1 < 30 %).
ABCD-Einteilung basiert auf Lebensqualität
Neben der Einteilung in GOLD-Stadien richtet sich die COPD-Therapie seit einigen Jahren auch nach der sogenannten ABCD-Klassifikation13. Grund dafür ist, dass der Lungenfunktionstest Verschlimmerungen – also Exazerbationen – und COPD-Symptome nicht immer gänzlich abbildet. Die Gruppierung basiert auf zwei Punkten13:
- Anzahl an Exazerbationen im letzten Jahr
- Ausmaß der Beschwerden
Daraus ergeben sich die vier Gruppen A (Anfangsstadium), B, C und D (Endstadium). Zusammen mit den GOLD-Stadien lauten die finalen Einteilungen also zum Beispiel „GOLD 1C“ oder „GOLD 3A“.
COPD: Die Lebenserwartung ist beeinflussbar
Die Weltgesundheitsorganisation WHO veröffentlicht zwar jährlich Sterblichkeitsstatistiken für ausgewählte Todesursachen, die Daten zu chronisch-obstruktiver Bronchitis sind hier allerdings mit Vorsicht zu verstehen12.
Das liegt unter anderem daran, dass der Ausdruck COPD darin uneinheitlich verwendet wird und unklar bleibt, in welchem Ausmaß die Lungenkrankheit zum Tod beigetragen hat12. Klar ist jedoch, dass COPD eine häufige Todesursache in den meisten Ländern ist12.
Doch es gibt gute Nachrichten: Mittels verschiedener Behandlungsmöglichkeiten können Betroffene einer COPD ihre Lebenserwartung und -qualität um einiges steigern.
Welche Therapie-Möglichkeiten gibt es bei COPD?
Eine chronisch-obstruktive Bronchitis ist zwar unheilbar, doch Betroffene können ihre Symptome mit den richtigen Maßnahmen selbst lindern – sodass die Lebensqualität aufrechterhalte bleibt oder sogar wieder verbessert wird3. Außerdem zielt die Behandlung darauf ab, die COPD zu verlangsamen und Exazerbationen (Verschlimmerungen) vorzubeugen3.
(Schleimlösende) Medikamente bei chronischer Bronchitis (COPD)
Die medikamentöse COPD-Therapie richtet sich immer nach dem Ausmaß der Erkrankung und wird stets mit dem behandelnden Arzt abgestimmt. Es kommen vor allem bronchienerweiternde und entzündungshemmende Arzneimittel zum Einsatz, die in der Regel inhaliert werden.
Auch sogenannte Mukopharmaka (schleimlösende Medikamente) können unterstützend eingenommen werden, um den Schleim bei einer COPD leichter abzuhusten und die Hustenattacken zu reduzieren. Eine regelmäßige Einnahme von GeloMyrtol® forte hat positive Effekte bei chronischer Bronchitis, verflüssigt den Schleim und erleichtert das Abhusten. Der pflanzliche Wirkstoff in den Kapseln ist ein Spezialdestillat, das aus rektifizierten Eukalyptus-, Süßorangen-, Myrten- und Zitronenöl besteht.
Ein weiterer Pluspunkt: Als rezeptfreies Medikament ist GeloMyrtol® forte in manchen Fällen erstattungsfähig. Je nach Kondition und Service übernimmt Ihre Krankenkasse die Kosten, wenn eine ärztliche Verordnung, ein privates oder Grünes Rezept vorliegt.
Weitere Behandlungsverfahren
Zusätzlich zu Medikamenten kommen verschiedene andere Behandlungen bei einer COPD infrage. Bewährte Therapieansätze sind zum Beispiel14,15:
- Atemübungen: Regelmäßiges Atemtraining bei einer COPD kann zwar die Lungenfunktion nicht verbessern, aber die Atemmuskulatur stärken und somit Atemnot vorbeugen. Die Übungen sind bei COPD Training für die körperliche Ausdauer und helfen dabei, den Schleim abzuhusten.
- pneumologische Rehabilitation: Sie besteht aus einem mehrwöchigen COPD-Behandlungsprogramm mit körperlichem Training, Übungen für die Atmung, Ernährungsberatung sowie einer Rauchentwöhnung. Das Konzept ist Bestandteil des Disease-Management-Programms (DMP) COPD und wird von Krankenkassen angeboten.
-
Ernährungsberatung: Einige Menschen mit COPD verlieren während des Verlaufs deutlich an Gewicht. Ihre Muskelkraft nimmt ab und sie sind im Alltag weniger belastbar. Dann hilft mitunter eine Ernährungsberatung – das gilt auch für den umgekehrten Fall, wenn also starkes Übergewicht die körperliche Belastbarkeit einschränkt.
-
Sauerstofftherapie und Heimbeatmung: In sehr weit fortgeschrittenen COPD-Stadien fällt das Atmen oft so schwer, dass eine Behandlung mit Sauerstoff notwendig ist. Dazu kommen sogenannte Sauerstoff-Konzentratoren oder Sauerstofftanks zum Einsatz. Auch der Einsatz einer Atemmaske ist möglich.
-
Patientenschulung: Darin lernen COPD-Patienten zum Beispiel den richtigen Umgang mit Medikamenten und Sauerstoffgeräten. Außerdem üben sie Inhalationstechniken und erlernen Verhaltensweisen für den Notfall. Ziel ist, dass die Patienten ihr Leben mit COPD so gut es geht selbst in die Hand nehmen. Die Schulungen sind ebenfalls Teil von Disease-Management-Programmen.
-
Bewegung: Betroffene können selbst etwas für die Verbesserung der Lebensqualität und die Linderung von Symptomen tun. Körperliche Aktivität zum Beispiel wirkt sich grundsätzlich positiv auf die Atmung aus14. Für COPD-Patienten bietet sich spezieller Lungensport an: Das sind besondere Angebote, die beispielsweise auf flottem Gehen oder Radfahren beruhen14.
-
Rauchentwöhnung: Am wichtigsten ist, mit dem Rauchen aufzuhören. Dadurch zeigen sich positive Effekte auf die Beschwerden sowie auf Lungenfunktion und Sterblichkeit14,16. Das ist oft leichter gesagt als getan – deshalb gibt es spezielle Entwöhnungsprogramme und Nikotinersatztherapien, die Betroffene dabei unterstützen.
Das Atemtherapiegerät GeloMuc® kann Betroffenen von chronischen Lungenkrankheiten wie COPD dabei helfen, den festsitzenden Schleim in den Bronchien zu lösen und so für ein besseres Wohlbefinden zu sorgen.

Wie lässt sich das COPD-Risiko verringern?
Die beste Methode, um einer chronisch-obstruktiven Lungenerkrankung vorzubeugen: Vermeiden Sie Auslöser und Risikofaktoren so konsequent wie möglich.
Von den zuvor aufgeführten muss vor allem das Rauchen hervorgehoben werden3. Lassen Sie sich professionell zur Rauchentwöhnung beraten und holen Sie sich Unterstützung – diesen Weg müssen Sie keinesfalls alleine gehen. Informieren Sie auch Ihr Umfeld über Ihr Vorhaben, dann bekommen Sie den nötigen Rückhalt und die Rücksichtnahme, die Sie brauchen.
Zusätzlich können Maßnahmen wie eine Atemschutzmaske helfen, die Belastung durch Schadstoffe in der Umwelt oder am Arbeitsplatz möglichst gering zu halten3.
Häufige Auslöser von Exazerbationen (Verschlimmerungen) sind Atemwegsinfekte3: Halsschmerzen, Fieber und Gliederschmerzen schwächen den Körper bei einer COPD zusätzlich3. Leider sind aber COPD-Patienten auch besonders anfällig für Infektionen. Deshalb ist es besonders in der Erkältungs- und Grippesaison wichtig, sich vor Ansteckungen zu schützen und sich gegebenenfalls gegen Grippe oder Pneumokokken impfen zu lassen3. Auch eine Impfung gegen COVID-19 empfiehlt sich, um den Körper im Falle einer Infektion zu stärken17.
FAQs
Oft gestellte Fragen und Antworten rund um COPD
COPD steht für den englischen Begriff chronic obstructive pulmonary disease – auf Deutsch chronisch-obstruktive Lungenkrankheit1. Dabei sind die Atemwege so verengt, dass keine vollständige Heilung mehr möglich ist1. Der Verlauf und die Beschwerden lassen sich jedoch beeinflussen.
Zu den typischen Symptomen zählen die sogenannten AHA-Beschwerden: Atemnot, Husten und Auswurf. Anfangs macht sich vor allem morgendlicher Husten bemerkbar, im weiteren Verlauf leiden Betroffene schon in Ruhe unter Atemnot.
Zunächst ist es wichtig, bei erstem Verdacht auf eine COPD ärztlichen Rat einzuholen. Der Experte entscheidet dann, ob zum Beispiel Medikamente oder weitere Schritte nötig sind. Zusätzlich können pflanzliche Schleimlöser wie GeloMyrtol® forte die Beschwerden bei COPD lindern.
Vor allem das Rauchen ist ein Auslöser von COPD. Weitere Risikofaktoren sind genetische Veranlagungen, starke Staubbelastung im Beruf, Luftschadstoffe oder Atemwegsinfekte in der Kindheit10.